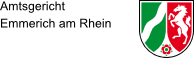Am 1. Oktober 1879, vor rund 125 Jahren, trat das schon am 27. Januar 1877 verkündete Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. Als eines der vier Reichs-Justizgesetze, neben Strafprozess-, Zivilprozess- und Konkursordnung, legte es die Grundlage für eine reichsweit einheitliche Organisation der Gerichte. An die Stelle der Stadt-, Kreis- und Patrimonialgerichte, Appellationshöfe, Justizsenate und des Obertribunals setzte es die bis heute bestehende Gerichtsordnung mit Amtsgerichten, Landgerichten, Oberlandesgerichten und Reichsgericht, die sich bis heute erhalten hat, sieht man davon ab, dass das Leipziger Reichsgericht 1945 aufgelöst und 1950 der BGH in Karlsruhe gegründet wurde. Über alle Brüche und Verwerfungen der deutschen Geschichte hat sich diese Einteilung erhalten. In Abwandlung des berühmten Wortes von Otto Mayer, dem Begründer des modernen Verwaltungsrechts, könnte man sagen: Verfassungsrecht kommt und geht, Gerichtsverfassungsrecht aber besteht.
So alt wie die Gerichtsverfassung ist auch das seinerzeit gegründete Amtsgericht Emmerich. Die damals rund 8000 Einwohner zählende Kleinstadt hatte schon bessere Zeiten gesehen. Auf die römische Siedlung Embrica zurückgehend, 697 erstmals urkundlich erwähnt, führt die Stadt immerhin das älteste deutsche Stadtwappen (von 1237), war seit 1407 Hansestadt und soll - wie Dederich in seinen Annalen der Stadt Emmerich 1867 behauptet - im 15. Jahrhundert 40.000 Einwohner gehabt haben, also mehr als Berlin, Hamburg und München damals zusammen. 1879 waren diese Glanzzeiten jedoch endgültig vorbei. Die von den Niederlanden, Brandenburg und Frankreich mehrfach besetzte, bombardierte und geplünderte Stadt kam unter dem Großen Kurfürsten zu Preußen, wo sie bis zur Auflösung des Landes blieb. Allerdings war Emmerich während der französischen Besatzung 1806 dem Großherzogtum Berg zugeschlagen worden und hat in der kurzen Zeit bis zur Rückkehr über die preußische Herrschaft französisches Recht kennengelernt. Nach dem Sieg über Napoleon fielen die Gebiete, welche bis 1805 preußisch gewesen waren - eben auch Emmerich - , sofort wieder an Preußen. Das übrige Rheinland folgte nach dem Wiener Kongress. Der kleine zeitliche Unterschied war aber folgenreich. Im Rheinland hatte man sich schnell mit dem Code Civil angefreundet, der mit Standesprivilegien aufgeräumt und die Gleichheit aller vor dem Gesetz durchgesetzt hatte. Gegen die Wiedereinführung des schon bei seinem Inkrafttreten 1794 anachronistischen Preußischen Allgemeinen Landrechts regte sich rheinischer Widerstand. Nach wie vor gab es in Preußen nämlich eine Zwei-Klassen-Justiz: Adlige und Beamte (außer Schulmeistern) genossen die "Exemtion". Sie waren nicht der niederen Gerichtsbarkeit, vor allem nicht den gutsherrlichen Patrimonialgerichten unterstellt, der Rechtszug begann für sie beim Oberlandesgericht und führte weiter zum Preußischen Obertribunal. Für die gemeinen Leute - Bauern, Handwerker, Tagelöhner, aber auch Kaufleute und Fabrikbesitzer und eben die Schulmeister - waren die Untergerichte zuständig. Im Strafrecht gab es für die höheren Stände die komfortable, nicht entehrende Festungshaft, für die niederen, zu denen auch das prosperierende selbstbewusste Bürgertum zählte, Zuchthaus, Gefängnis und körperliche Züchtigung. In Berlin wollte man der, wie es hieß "unter Phrasen liberaler Duldung… im Code der revolutionären Sittenlosigkeit umhergetriebenen" rheinischen Bevölkerung wieder Ordnung beibringen, aber die Rheinländer setzten mit beharrlicher Resistenz die Beibehaltung französischen Rechts durch. Es galt also weiter, auch nach Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze, der Code Civil, und zwar bis zum Inkrafttreten des BGB. Bis zum 31. Dezember 1899 gab es beim Reichsgericht sogar einen Zivilsenat, genannt " der Französische Senat", welcher Revisionen nach dem napoleonischen Gesetz entschied. Das galt freilich nicht für Emmerich. Die altpreußischen Gebiete wurden sofort wieder preußischem Recht unterstellt, gegen das sich freilich, wie allgemein gegen preußische Restauration und Despotie, landesweit Widerstand formierte. Und dieser wurde vor allem von Richtern angeführt.
Einer der Richter, die mit ihrer freiheitlichen Einstellung in Opposition zur Obrigkeit gerieten, war der Komponist, Schriftsteller und Jurist Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. As Kammergerichtsrat und Mitglied einer "Immediatkommission zur Ermittelung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe" hatte er das Vorgehen der Polizei gegen den als Demagogen verfolgten Turnvater Jahn als "ein ganzes Gewebe heilloser Willkür, frecher Nichtachtung der Gesetze und persönlicher Animosität" entlarvt. Das daraufhin eingeleitete Dienststrafverfahren - sinnigerweise wegen "Preisgabe von Prozessgeheimnissen" - kam nicht mehr zum Abschluss. Hoffmann starb am 25 Juli 1822, sein Gegenspieler, der Polizeidirektor von Kamptz wurde 1832 preußischer Justizminister.
Die Frankfurter Nationalversammlung von 1848 bestand zu einem Viertel aus Richtern und Rechtsgelehrten. Einer von ihnen, Benedikt Waldeck, wurde 1849 wegen angeblichen Hochverrats ein halbes Jahr lang eingesperrt. Später, als Abgeordneter des preußischen Landtags, war er Wortführer der Freisinnigen und einer der beharrlichsten Gegner Bismarcks. Waldecks Popularität zeigte sich zuletzt bei seinem Begräbnis; der Trauerzug von 20000 Menschen war der größte, den Berlin je gesehen hatte. Der Münsteraner Oberlandesgerichtsdirektor Jodokus Donatus Temme hatte gar aus dem Gefängnis heraus für die Nationalversammlung kandidiert und war prompt gewählt worden. Von der Anklage wegen Hochverrats wurde er zwar freigesprochen, nach einem Disziplinarverfahren jedoch ohne Bezüge entlassen. Richter lehnten sich auch gegen den politischen Missbrauch der Justiz auf. Schon 1844 hatte Heinrich Simon, Stadtgerichtsrat in Breslau, unter Hinweis auf die staatliche Gängelung der Justiz prophezeit: "Er wird fallen, der bisher so edle preußische Richterstand… und die Trümmer dieser Institution werden auf den preußischen Thron stürzen und auf die bürgerliche Freiheit des preußischen Volkes". Ein Jahr später gab er sein Richteramt auf und schrieb an den König den bemerkenswerten Satz: "Nur auf das kann man sich stützen, was Widerstand leistet". Für seine führende Rolle bei der Revolution wurde er in Abwesenheit, er war inzwischen in die Schweiz emigriert, zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
Auch die nachrevolutionären Parlamente waren von politisch bewussten Richtern dominiert. Das 1862 gewählte preußische Abgeordnetenhaus, in dem 230 Liberalen nur 11 Konservative gegenübersaßen, nannte man wegen seines hohen Richteranteils "Kreisrichter-Parlament". Über Jahre führte es im preußischen Verfassungskonflikt einen zähen Kampf gegen das reaktionäre preußische Regime. Der Abgeordnete Carl Twesten, Stadtrichter in Berlin und landesweit bekannt geworden durch eine Reihe von Flugschriften, deren eine überschrieben war mit "Freund, jetzt ist Zeit zu lärmen", hatte Manipulationen der Regierung bei der Besetzung von Richterämtern aufgedeckt und hatte sich damit ein Strafverfahren eingehandelt. Nach einem erregten Rededuell zwischen Twesten und Bismarck im Landtag missbilligten 283 Abgeordnete die Maßregelung des Richters, nur 35 stimmten mit Bismarck . Dieser sprach damals abschätzig von "Kreisrichtern und anderen Revolutionärs". Nicht ganz zu Unrecht, denn viele Richter hatten eine revolutionäre Vergangenheit und sogar der eher staatstragende erste Präsident des 1879 gegründeten Reichsgerichts, Martin Eduard von Simson, soll im März 1848 an der Seite aufrührerischer Studenten auf den Barrikaden gestanden haben.
Nach der Reichsgründung von 1871 und erst recht nachdem der zum Reichskanzler aufgerückte preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck seit 1878 seine Regierung nicht mehr auf die nationalliberale Fraktion, sondern auf die Konservativen im Reichstag stützte, versuchte die Regierung, mit einer Reihe ultrakonservativer Säuberungsmaßnahmen dem fortschrittlichen Teil der Richterschaft das liberale Kreuz zu brechen. Nach einer drastischen Verminderung der Zahl der Gerichte wurden die Richter der zehn ältesten Jahrgänge entlassen, jener, deren politisches Bewusstsein noch durch die Revolution von 1848 und dem Verfassungskonflikt geschärft war. Da in den Folgejahren keine Richterstellen frei wurden, musste, wer das Richteramt anstrebte, nach Studium und vierjähriger unbezahlter Referendarzeit ein acht bis zehn Jahre dauerndes Assessoriat durchlaufen. Als Hilfsrichter auf Probe hatte er ohne die Garantie richterlicher Unabhängigkeit zu arbeiten. Das wirkte in mehrfacher Hinsicht prägend auf die künftige Richterschaft. Zunächst einmal war eine soziale Selektion gewährleistet, denn nur Begüterte konnten sich die rund zwanzigjährige Ausbildung leisten, und bis 1911 in Preußen nur zum Referendardienst zugelassen, wer 7500 Mark hinterlegt und ferner nachgewiesen hatte, dass er über ein standesgemäßen Unterhalt von jährlich 1500 Mark verfügt. Aus Vorbereitungsdienst und dem Proberichteramt konnte man jederzeit entlassen werden. Die lange Ausbildung gab die Möglichkeit, die Richter zu beobachten und alle oppositionellen Elemente auszusondern.
Die permanente Examinierung überstand nur, wer in besonderem Maße staatstreu und willfährig war, kurz: wer das damalige Gesellschafts- und Staatssystem bedingungslos akzeptierte. Die 1878 angeführte "freie Advokatur" - für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wurden alle politischen Schranken aufgehoben und aus dem öffentlichen Amt des Justizkommissars der freie Beruf des Rechtsanwalts gemacht - hatte obendrein zur Folge, dass Richter mit liberaler Einstellung den Dienst quittierten, um Anwalt zu werden.
Höhere Richterstellen besetzte man damals vorzugsweise mit bewährten Staatsanwälten. Diese waren im Gegensatz zu Richtern abhängig und an Weisungen der vorgesetzten Behörde gebunden, also Beamte, die in langer Berufsausübung Gehorchen gelernt hatten. Als "politische Beamte" konnten Staatsanwälte jederzeit ohne Angaben von Gründen in den Ruhestand versetzt werden, daher hielt sich in dieser Berufsgruppe nur der hochkonservative neue Typ des obrigkeitsgläubigen Staatsdieners, dessen Denkweise und Gebaren der Historiker Leo Kofler in seiner "Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft" so treffend beschrieb: "Formalistische Pflichtbetonung, falscher, weil mit dem Leben in einem ständigen, auf tragischen Konflikt geratener Ehrbegriff, Duckmäuserei, verbunden mit Neigung zur heldischen Haltung, rationalisierte Sentimentalität und - preußischer Haarschnitt". Obwohl die Staatsanwälte nur acht Prozent des höheren Justizpersonals stellten, rekrutierte man die Mehrheit der Präsidenten für die neu geschaffenen Amts- , Land- und Oberlandesgerichte aus der Staatsanwaltschaft.
In der Richterschaft des Kaiserreichs hatte sich die "Metamorphose liberaler Honoratioren zu Reserveoffizieren" mit beängstigender Geschwindigkeit vollzogen. "Unabhängigkeit der Rechtspflege?" beschreibt der Rechtssoziologe Ernst Fraenkel die Haltung der Richter jener Zeit, "de jure hat sie nie jemand angezweifelt; de facto nie jemand angestrebt". Die Richterschaft stand überwiegend stramm zur Monarchie und es war fast überflüssig, dass einer ihrer Sprecher, Senatspräsident Max Reichert, forderte: "Was die Wehrmacht nach außen ist, das muss die Rechtsprechung nach innen sein".
Es klingt zwar revolutionär, wenn der 1879 in Kraft getretene und bis heute in seinem Wortlaut unveränderte § 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes dekretierte: "Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetze unterworfene Gerichte ausgeübt". Diese Garantie wird jedoch relativiert durch das zynische Wort des von 1867 bis 1877 amtierenden preußischen .(ab 1871 auch Reichs-) Justizministers Gerhard Adolf Leonhardt: "Solange ich über die Beförderungen bestimme, bin ich gern bereit, den Richtern ihre sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren".
Schon der Norddeutsche Bund hatte versucht, mit der Rechtszersplitterung in den verschiedenen Mitgliedsländern Schluss zu machen und 1868 den Bundeskanzler Bismarck ersucht, Entwürfe für einheitliche Prozessordnungen und eine Gerichtsverfassung erarbeiten zu lassen. Erste, 1873 vorgelegte Ergebnisse enttäuschten jedoch alle Reformhoffnungen. Das vorgesehene Strafverfahren war der reinste Inquisitionsprozess, und die Aufsicht über die Gerichte sollte die Staatsanwaltschaft führen.
Der Reichstag setzte zur Bearbeitung der Entwürfe eine 28-köpfige "Reichsjustizkommission" unter Vorsitz Johannes von Miquels ein, der so große Liberale wie Otto Bähr, Richter aus Kassel, Rudolf von Gneist, Eduard Lasker und der sächsische Generalstaatsanwalt von Schwarze angehörten. Die Kommission fällte vernichtende Urteile über die Entwürfe, stieß aber bei den Konservativen, die im Reichstag zwar nur eine kleine Minderheit bildeten, jedoch den Bundesrat völlig beherrschten, auf erbitterten Widerstand. Dieses von den deutschen Fürsten bestellte Gremium, (die Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen hatten nur je eine Stimme, also drei von 58), war eine echte Zweite Kammer, musste also allen Gesetzen zustimmen. Und im Bundesrat herrschten, vor allem in der Justizpolitik, die reaktionärsten Vorstellungen. Die am 21. Dezember 1876 schließlich verabschiedeten Reichsjustizgesetze stellten daher nur einen Kompromiss zwischen liberalen Reichstagsideen und rückständigen Bundesratsforderungen dar. Sie wurden von der juristisch interessierten Öffentlichkeit vernichtend beurteilt. Karl Binding sprach von "Stück- und Flickwerk" und im Hinblick auf den Strafprozess von einer "hässlichen Bastardform", insbesondere die "unerträgliche Herrenstellung" der Staatsanwaltschaft stieß in der liberalen Professorenschaft auf geschlossene Ablehnung.
Und doch muss man rückblickend feststellen, dass der Reformschritt von 1879 rechtsstaatliche Standards gesetzt hatte, die später nie wieder erreicht wurden. Die Justizbürokratie hat in der Folgezeit nichts unversucht gelassen, den Reformschritt von 1879 rückgängig zu machen. Wenn auch Gliederung und Aufgaben der Gerichte seit 125 Jahren gleich geblieben sind, so hat sich doch in ihrer Besetzung und Zuständigkeit vieles verändert.
Die Amtsgerichte waren damals in Zivilsachen für Streitwerte bis 600 Mark zuständig, für Strafsachen gab es beim Amtsgericht nur das Schöffengericht und dieses konnte allein Übertretungen und leichte Vergehen aburteilen und zu höchstens drei Monaten Gefängnis verurteilen. Die Strafkammern beim Landgericht waren mit fünf Richtern besetzt, ebenso die Senate des Oberlandesgerichts, die Reichsgerichtssenate hatten sogar sieben Mitglieder. Für Kapitaldelikte war ein Schwurgericht mit drei Richtern und 12 Geschworenen zuständig.
Vor allem dieses sehr populäre Gericht war der Justizverwaltung von Anfang an ein Dorn im Auge, wie überhaupt jede Form von Laienbeteiligung und von Kollegialgerichten. Wenn man von einem Kontinuum über 125 Jahre hinweg reden kann, so ist es der permanente Kampf der Justizbürokratie gegen den Reformschritt von 1879. Jeden vermeintlichen oder tatsächlichen Notstand nahm sie zum Anlass, Rechtsmittel einzuschränken, die Gerichtsbesetzung zu verkürzen, im Strafprozess das Beweisrecht zu beschneiden und die Laienbeteiligung zurückzudrängen. Als zum Beispiel 1923 chaotische Zustände im Reich herrschten - Ruhrgebietsbesetzung durch die Franzosen und bürgerkriegsähnliche Zustände dort, galoppierende Inflation, Hitlerputsch in München - und als Reichskanzler Stresemann nach dem Einmarsch der Reichswehr in Sachsen und Thüringen zurücktreten musste, bekam dessen Nachfolger Wilhelm Marx umfassende Notstandsvollmachten zur Bewältigung der Krise. Und deren erste Maßnahme zur Bewältigung der verschiedenen Notstände war die Emminger-Verordnung vom 4. Januar 1924, benannt nach dem erst seit drei Wochen amtierenden Justizminister, mit der die Schwurgerichte abgeschafft wurden.
Mit dem Untergang des Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik war für die monarchistisch gesonnene Richterschaft eine Welt zusammengebrochen. "Jede Majestät ist gefallen, auch die Majestät des Gesetzes" klagte der Richterbundsvorsitzende Johannes Leeb. In den Gesetzen der Republik sah er "Lügengeist" und "Partei-Klassen-, Bastardrecht". Der neue Staat garantierte der alten Richterschaft jedoch ihre Unabhängigkeit und bot Richtern, die meinten, es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren zu können, der Republik statt dem Kaiser zu dienen, sich bei Wahrung aller materiellen Ansprüche in den Ruhestand versetzen zu lassen. Davon machten aber nur 0,15 % Gebrauch, der Rest blieb und saß mehr oder weniger die Republik aus.
Nach der Demütigung von 1918, jetzt einer demokratischen Republik dienen zu müssen, folgte 1922 eine weitere. Die ohnehin nicht besonders geliebte Reichsverfassung vom 11. August 1919 sah in Art. 109 für Männer und Frauen "grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten" vor und Art. 128 präzisierte: "Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen. Alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt". Der im Oktober 1921 zum Reichjustizminister ernannte sozialdemokratische Rechtsphilosoph Gustav Radbruch wollte daher auch Frauen zum Richteramt zulassen. In der Richterschaft herrschte Aufruhr und in der Deutschen Richterzeitung schrieb der Richter Hoffmann, "die Einführung der Frau in den Richterberuf würde einen Abbau unserer Rechtsordnung bedeuten", denn "zur Rechtssprechung sind der Frau unüberwindliche Grenzen in ihrer Begabung gezogen". Ein Gutachter des Richterbundes, Kollege Stadelmann konkretisierte, dass "Gefühlseinflüsse… die Frau bereits bei der intelligenzmäßigen, objektiven Aufnahme von Tatvorgängen behindern", kurz: "Durch die Zulassung der Frau als Berufsrichterin würde der Rechtsprechung das Grab gegraben". Der vierte deutsche Richtertag 1921 lehnte mit 248 : 2 Stimmen die Zulassung von Frauen ab, denn "das Recht nötigt zu festem kampfweisen Vorgehen" hieß es in der Diskussion und das ließe sich "mit der Eigenart weiblichen Denkens und Empfindens kaum vereinbaren".
In einem viel beachteten Vortrag vor der Münchner juristischen Gesellschaft am 7. Geburtstag der Republik, dem 9. November 1926 beschrieb Reichsgerichtspräsident Dr. Walter Simons die Psyche seiner Kollegen: "Bei uns ist das Richtertum der Monarchie als Ganzes in den neuen Staat hineingegangen… mit vollem Bewusstsein, aber mit dem neuen Regime bekam der Richter nicht den neuen Geist…Der deutsche Richter ist konservativ." Zum Skandal wurde die Rede durch die Forderung des auf Vorschlag eines sozialdemokratischen Justizministers von einem sozialdemokratischen Staatsoberhaupt ernannten Reichsgerichtspräsidenten, Sozialdemokraten fehle die nötige Unabhängigkeit, sie dürften daher nicht zu Richtern ernannt werden. Das war schon im Kaiserreich so gewesen und die große Mehrheit der Richterschaft teilte die Meinung des Reichsgerichtspräsidenten.
Die wenigen Kollegen, die sich dem in der Richterschaft vorherrschenden deutsch-nationalen Konsens verweigerten, wurden heftig angefeindet. Immer wenn ein Richter sich öffentlich zur Republik oder demokratischer Ordnung bekannte, löste er damit ein regelrechtes Kesseltreiben aus, das auch schon antisemitische Züge trug, denn die jüdischen Richter waren eher in den Parteien der Weimarer Koalition engagiert als in den deutlich antisemitischen Rechtsparteien. Arnold Freymuth zum Beispiel, seit 1911 Oberlandesgerichtsrat in Hamm wurde nach seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg Pazifist und Mitglied der SPD, 1918/19 Mitglied eines Bauern- und Soldatenrates, 1919 parlamentarischer Unterstaatssekretär im preußischen Justizministerium und kam 1920 ans Kammergericht, wo er 1923 zum Senatspräsidenten avancierte. Als nach Freymuth und Hermann Großmann, seit 1919 Rat am Oberlandesgericht Marienwerder (Westpreußen),1922 zum Senatspräsidenten beim Kammergericht berufen, ein Jahr später auch Alfred Orgler ans Kammergericht kam, gab es dort eine Protestversammlung von rund 100 Richtern, die sich gegen die Beförderung der drei Republikaner empörten. Großmann wurde im Frühjahr 1930, kurz vor dem Sturz des letzten Kanzlers der Weimarer Koalition, Hermann Müller, sogar zum Reichsgerichtsrat ernannt. Unter den 122 Mitgliedern dieses höchsten Gerichts blieb er aber ein Fremdkörper. Als er im November 1932 auf einer Reichsbanner-Versammlung ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Reichsverfassung abgelegt und zu deren Verteidigung aufgerufen hatte, leitete Reichsgerichtspräsident Bumke ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein, da er "in hohem Maße die Zurückhaltung vermissen lässt, wie…. von einem Mitglied des höchsten Gerichtshofes… erwartet werden muss". Der Vorgang ging ans Justizministerium und am 6. März 1933 forderte Reichsjustizminister Gürtner Großmann auf, seine sofortige Versetzung in den Ruhestand zu beantragen. Der erst 55-jährige kam dem umgehend nach und kam damit seiner Entlassung zuvor. Nach § 4 des am 7. April von der Reichregierung erlassenen Gesetzes "zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" konnten Beamte, "die nach ihrer bisherigen politischen Tätigkeit nicht die Gewähr dafür boten, jederzeit für den nationalen Staat" einzutreten, mit gekürztem Ruhegehalt entlassen werden. Großmanns Antrag ermöglichte es dem Reichsgerichtspräsidenten, ans Ministerium zu melden, beim Reichsgericht sei kein einziger von der politischen Klausel betroffen. Nach einer Durchführungsverordnung zu dem Gesetz hatten die Beamten Auskunft über Mitgliedschaft in demokratischen Parteien, dem Reichsbanner, dem Republikanischen Richterbund und der Liga für Menschenrechte zu geben, Großmann gehörte allen vieren an.
Bemerkenswert ist, dass obwohl Preußen von 1918 bis zum 20. Juli 1932 - dem sog. Preußenschlag - durchgehend sozialdemokratisch regiert wurde, von den rund zehntausend höheren Justizbeamten (Richtern, Staatsanwälten und Assessoren) nur 97 unter die politische Klausel fielen. Beim Reichsgericht nur ein einziger: Hermann Großmann.
Der deutsche Richterbund hatte in den 14 Jahren der Republik stets das "Eindringen der Politik in die Rechtspflege" bekämpft. Mit dem Protest hatte es aber ein Ende, als die Nazis an die Macht gekommen waren. Obwohl schon am 1. April anlässlich einer Judenboykottaktion die Justizminister der Länder alle die jüdischen Richter, Staats- und Amtsanwälte beurlaubt hatten und am 7. April das bereits mehrfach erwähnte Berufsbeamtentumsgesetz die Entlassung jüdischer, sozialdemokratischer und anderer politisch unzuverlässiger Richter und Beamten dekretierte, womit die Unabhängigkeit der Richterschaft aufgehoben worden war, teilte der Richterbundvorsitzende nach einer Audienz - ausgerechnet am 7. April - beim Reichskanzler mit: "Wir legten alles vertrauensvoll in seine Hand. Der Herr Reichskanzler war mit diesen Einführungen offenbar einverstanden und erklärte, dass er die Unabhängigkeit der Richter aufrechterhalten werde, wenn auch gewisse Maßnahmen notwendig seien".
Dann ging es Schlag auf Schlag: Am 21. April forderte der Verein Preußischer Richter und Staatsanwälte seine Mitglieder auf, "sich in die gemeinsame Kampffront Adolf Hitlers einzugliedern und sich dem Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen anzuschließen", der oldenburgische Richterverein löste sich am 29. April auf, der Vorstand des Richtervereins beim Reichsgericht trat am 10. Mai "zum Zwecke der Gleichschaltung" zurück und am 21. Mai stellte sich der Verein sächsischer Richter und Staatsanwälte "freudig und pflichtgetreu unter die Führung des Volkskanzlers Adolf Hitler". Am 23. Mai erklärte schließlich der Reichsvorstand des Richterbundes in einem Telegramm an den "Reichsjuristenführer" Hans Frank "für sich und die ihm angeschlossenen Landesvereine seinen korporativen Eintritt in den nationalsozialistischen Juristenbund und unterstellt sich der Führung des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler".
So lange das Zentralorgan des Richterbundes, die Deutsche Richterzeitung, noch existierte - sie wurde später in die regierungsamtliche Deutsche Justiz überführt, war sie nun Forum für Vorschläge der Richterschaft zur Neugestaltung der Rechtsordnung. Reichsgerichtsrat Erich Schultze z.B. plädierte hier bereits 1933 für die scharfe Bestrafung von "Rasseverrat… , d. i. kurz gesagt die Vermischung eines Deutschen mit Angehörigen bestimmter gesetzlich bestimmter Rassen". Als deutliches Zeichen der vollendeten Gleichschaltung schworen schließlich am 13, Oktober 1933 anlässlich des ersten Juristentages nach Hitlers Machtergreifung, zugleich vierte Jahrestagung des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen, auf einer imposanten Massenkundgebung vor dem Reichsgericht über 10000 Juristen mit erhobenem rechten Arm, "bei den Opfern einer volksfremden Justiz und der Seele des deutschen Volkes, dass wir unserem Führer auf seinem Wege als deutsche Juristen folgen werden bis an das Ende unserer Tage". Vorher waren tausende gestandener Juristen feldmarschmäßig ausgerüstet sternförmig zu Fuß auf Leipzig zumarschiert, was der jüdische Schriftsteller und Rechtsanwalt Rudolf Olden kommentiert "ein Volk, das seine Richter zu Feldwebeln degradiert, ist meilenweit entfernt von jeder europäischen Rechtskultur".
Nach einem Geschäftsbericht des preußischen Justizministeriums führte das Berufsbeamtengesetz zur Entlassung von 311 Richtern und 804 Referendaren wegen "nichtarischer" Abstammung, wegen nationaler Unzuverlässigkeit wurden 97 aus ihrem Amt entfernt, 27 gaben ihr Amt freiwillig auf. Ausgeschlossen wurden auch die 36 Richterinnen, denen von 1922 - 1933 der Eintritt in den Justizdienst gelungen war. Daneben gab es 176 Gerichtsassessorinnen, meist Proberichterinnen. Für das Ausscheiden der Frauen gab es kein Gesetz, nur Hitlers Aversion gegen Frauen in Richterrobe. Die schon zu Lebenszeitrichterinnen ernannten wurden in den Verwaltungsdienst abgeschoben oder in Grundbuch- oder Registerabteilungen versetzt. Ab 1935 wurden Frauen generell nicht mehr zu Gerichtsassessoren ernannt und auch nicht mehr zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.
Direkte Eingriffe der Exekutive in die Rechtsprechung waren im Dritten Reich selten. Mit den neuen Rechtsmitteln der Nichtigkeitsbeschwerde und des Außerordentlichen Einspruchs, beide waren auch gegen rechtskräftige Urteile möglich, hatte die Staatsanwaltschaft ohnehin große Möglichkeiten, missliebige Entscheidungen revidieren zu lassen. Die Unabhängigkeit der Justiz als ganzer existierte dagegen nicht mehr. Die Gerichtsverwaltungen waren nach dem "Führerprinzip" organisiert, die ohnehin geringe Richtermitbestimmung abgeschafft. Da alle Akte staatlicher Gewalt vom Entzug der Fahrerlaubnis bis zur "Schutzhaftverhängung" der richterlichen Kontrolle entzogen waren und sogar Gerichtsurteile von der Polizei "korrigiert" werden konnten, war die dritte Staatsgewalt, nachdem die anderen zwei mit dem Ermächtigungsgesetz schon zusammengelegt worden waren, entmachtet und zur Legitimationsbeschafferin degradiert. Zu dieser Entwicklung hat die Justiz selbst erheblich beigetragen. Schon 1933, als die nationalsozialistischen Rechttheoretiker noch gar nicht auf die Idee gekommen waren, dass es gegen Polizeiaktionen keinerlei Rechtsschutz gebe, hatte das Kammergericht alle "reichs- und landesrechtlichen Schranken für polizeiliche Maßnahmen (für) beseitigt" erklärt und festgestellt, dass deren "Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Überprüfung durch das Gericht nicht unterliegt".
Die persönliche Unabhängigkeit der Richter haben die Machthaber nach den Massenentlassungen im Jahr 1933 dagegen in erstaunlichem Maß respektiert. Die nach dem Krieg immer wieder zitierten Richterbriefe waren nicht mehr als anonymisierte Kritiken einzelner Gerichtsurteile. Sie hatten keinerlei Prangerwirkung und waren auch keine Urteilskorrekturen. Verblüffend ist, dass mutigen Richtern und Staatsanwälten, die gegen das Unrecht des Systems vorgingen, nichts anderes widerfuhr, als die Versetzung oder die Verabschiedung in den Ruhestand. Der Brandenburger Vormundschaftsrichter Lothar Kreyssig ging in Pension, nachdem er Mordanzeige gegen den Reichsleiter Bouhler und den Medizinprofessor Brandt, die von Hitler mit der Behindertenmord-Aktion Beauftragten, erstattet und, ins Justizministerium vorgeladen, erklärt hatte, solch verbrecherische Führerbefehle könne er nicht als Recht akzeptieren. Der Münchener Staatsanwalt Josef Hartinger hatte schon 1933 nach einigen Todesfällen im Lager Dachau gegen zwei Wachmänner Anklage wegen Mordes und gegen den Lagerkommandanten wegen Begünstigung erhoben. Die Sache wurde zwar niedergeschlagen, aber Hartinger entzog man lediglich die Zuständigkeit für Dachau. Das Dritte Reich überdauerte er als Amtsrichter in Amberg.
Der Richterschaft wurde ihre Unabhängigkeit nicht genommen, sie gab sie freiwillig ab, "freudig und pflichtgetreu", wie es in den Entschließungen des Richterbundes hieß. Der pensionierte Kölner Landgerichtspräsident Hubert Schorn kommt der Wahrheit schon sehr nahe, wenn er in seiner Justiz-Reinwaschungsschrift "Der Richter im Dritten Reich" schreibt: "Die stolze Geschichte der Richterschaft durchzogen stets die Treue zur Staatsführung und die Liebe, mit der man dem Staate diente". Diese Staatshörigkeit großer Teile der Richterschaft machte ihre Anpassung ans Dritte Reich so reibungslos und nicht - wie später immer behauptet - die Treue zum Gesetz. Machtvergötzung, Verrohung der Staatspraxis und Inhumanität bestimmten das Dritte Reich. Die Justiz hat ihr Teil dazu beigetragen.
Am 29. November 1944 meldet der Düsseldorfer OLG-Präsident an Justizminister Thierack, "der Lärm der Großschlachten" halle bis an den Niederrhein und "wirke lähmend auf ängstliche Gemüter" auch in der Justiz. Die Gerichtsgebäude von Kleve, Emmerich, Solingen, Moers und Erkelenz seien zerstört, defätistische Äußerungen in der Bevölkerung nähmen zu und "Verzagtheit" sei auch bei vielen Gefolgsmitgliedern festzustellen, er aber hielte, obwohl rund 550 Justizangehörige zum Kriegsdienst abgeordnet seien, durch. Lange musste er das nicht mehr. Wenige Wochen später war das System am Ende. Nicht jedoch die Justiz. Zwar ordnete der Befehlshaber der alliierten Streitkräfte in seiner Proklamation Nr. 1 an: "Alle deutschen Gerichte… innerhalb des besetzten Gebietes werden bis auf weiteres geschlossen", aber man lebte "in der Fiktion des Fortbestehens des Dienstbetriebes", wie es in einem Bericht von 1945 hieß. Obwohl auch das höchste Gericht zusammen mit dem Volksgerichtshof und dem Reichskriegsgericht geschlossen worden war, gab es bis ins Jahr 1946 zahlreiche Anfragen "An das Reichsgericht, Leipzig", wann mit der Rückgabe der Akten zu rechnen sei, die "zur Prüfung der Nichtigkeitsbeschwerde nach dort gesandt" wurden. Nichtigkeitsbeschwerde war das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft zur Verschärfung zu "milder" Sondergerichtsurteile.
"Wie die meisten Deutschen", beschreibt der Frankfurter Rechtshistoriker Dieter Simon die Nachkriegssituation, "blickten auch die Juristen auf die Trümmer ihrer Welt… . Die Rechtsprechung schien gedemütigt, beschmutzt und befleckt, Rechtskunde war eben noch eine korrupte Legitimationswissenschaft gewesen… . In dieser Lage stellten sich den Juristen zwei Fragen: Warum war dies geschehen? Was war jetzt zu tun?" Auf die erste Frage gab Gustav Radbruch, einer der wenigen in Deutschland gebliebenen gleichwohl nicht korrumpierten Juristen, ehemaliger Reichsjustizminister und Rechtsphilosoph in Heidelberg die falsche und verhängnisvolle Antwort: "Der Positivismus, den wir schlagwortartig zusammenfassen können in die Formel 'Gesetz ist Gesetz' hat die deutsche Rechtswissenschaft und Rechtspflege wehrlos gemacht gegen noch so große Grausamkeit und Willkür, sofern sie nur von den damaligen Machthabern in die Form des Gesetzes gebracht wurden". Damit lieferte er die Stichworte für die juristische Nachkriegsdebatte. Der Rechtsprofessor und Kriegsgerichtsrat a.D. Eberhard Schmidt behauptete auf dem ersten. Nachkriegsjuristentag: "Nicht die Justiz, sondern ganz allein der Gesetzgeber hat die Fahne des Rechts verlassen… mit der Verantwortung für die Folgen dürfen heute weder Rechtswissenschaft noch Justiz beladen werden".
Der Verweis auf den Rechtspositivismus wurde zur zentralen Lebenslüge der deutschen Juristen zur Erklärung ihres Beitrags zum Naziunrecht. Dass es eine Lüge war, wussten sie alle, denn wenn es jemals eine antipositivistische Rechtspraxis gegeben hat, war es die des Dritten Reichs. Entsprechend grotesk war das, was man in der Nachkriegszeit "positivistisch" nannte. Carlo Schmidt, Sprecher der SPD im parlamentarischen Rat, zählte sogar den Grundsatz "Recht ist, was dem Volke nützt" zur "positivistischen Entartung" und das Landgericht Kassel entschuldigte Blutrichter, die in "schöpferischer Gesetzesauslegung" einen sogenannten Rasseschänder zu der nicht vom Gesetz vorgesehenen Todesstrafe verurteilt hatten: "Berücksichtigt man, dass die Angeklagten im rechtspositivistischen Sinne erzogen und möglicherweise überzeugte Nationalsozialisten waren, … ist nicht auszuschließen, dass sie positiv geglaubt haben, ihre Entscheidung entspreche dem Gesetz".
Die Geschichtsklitterung bot doppelten Vorteil: einerseits wurde der gesamte Berufsstand rein gewaschen, andererseits "der Gesetzgeber", dem man misstraute, diskreditiert. Mit der Berufung auf eine "letzte rechtliche Ordnung jenseits des wissenschaftlich Zwingenden oder gar des formal logischen Evidenten" behielt man sich vor, die Gesetze am "übergesetzlichen Recht" zu messen. Hermann Weinkauff, erster Präsident des Bundesgerichtshofs und Reichsgerichtsrat a.D., propagierte weiter "einen geschlossenen Richterstand, ja einen wirklichen Rechtsstand". Was dem entgegenstand, eine "pluralistische Gesellschaft" und der "Pluralismus der Weltanschauungen" nannte er noch 1968 "Dinge, bei denen die Sache so bedrohlich wie die Bezeichnung widerwärtig ist".
Dass man jetzt von den Richtern eine demokratische Gesinnung verlangte, empfanden sie als Zumutung. Der Celler OLG-Präsident Hodo von Hodenberg beklagte, dass die britische Besatzungsmacht "durch Drohung mit Amtsverlust oder Freiheitsberaubung bestimmte Gesinnungen" erzwingen wolle, nicht anders als die Nazis, nur "mit umgekehrten Vorzeichen". Mit der Forderung nach Entpolitisierung der Justiz sollte die Richterideologie der Weimarer Zeit neu belebt werden. "Recht ist eine Idee an sich" schrieb Landgerichtsdirektor Hans Rotberg 1947 und diese dulde "keine Relativierung, auch keine demokratische". Der Richter sollte "ein Gelöbnis politischer Keuschheit darbringen und jeder, "der diesem Stande beitritt, sollte… sich prüfen, ob er dem Orden der Diener und Hüter des Rechts" angehören kann. Solche Worte mögen uns komisch vorkommen, von einem, der zwei Jahre zuvor noch seinem Führer bedingungslos gehorsam war, Rotberg, haben sie einen Ruf an den BGH und sogar einen Senatsvorsitz dort eingebracht.
Die siebziger Jahre brachten, so unruhig es innenpolitisch in der Bundesrepublik auch war und so krisenhaft der Rechtsstaat auf terroristische Bedrohungen reagierte, Fortschritte für die Entwicklung der richterlichen Unabhängigkeit. "Eine neue Generation von Richtern trat in Erscheinung", schreibt Dieter Simon in seiner Studie zur richterlichen Unabhängigkeit, "sie waren politisch interessiert, aber nur mäßig engagiert. Sonst wären sie nicht Richter geworden. Aber mit den neuen Richtern und der Pensionierung der letzten Alten hielt ein neuer Ton Einzug in die Gerichtssäle, eine neue Sensibilität breitete sich aus. Die Vergangenheit der deutschen Justiz wurde nicht länger verdrängt, sondern sogar richterakademiewürdig". 1972 wurden Direktoren und Senatspräsidenten durch Vorsitzende Richter ersetzt und mit der neuen Richterbesoldung die Voraussetzung für eine größere Unterscheidung zwischen Beamten und Richtern geschaffen.
Inzwischen stehen auch die in den Siebzigern eingestellten Richter zur Pensionierung an. Die Justiz hat sich gottlob nicht so entwickelt, wie von Hermann Weinkauff herbeigesehnt. Sie ist pluralistisch, demokratisch und peinlich auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Geblieben sind jedoch eine 125 Jahre alte Ausbildungsordnung und eine Gerichtsverfassung, welche den Einfluss der Justizbürokratie auf die Besetzung vor allem der Beförderungsämter ganz im Sinne des eingangs zitierten preußischen Justizministers Leonhardt sichern. Eigentlich sind die Grenzen dieser Gerichtsverfassung erst in den letzten Jahrzehnten so recht offenbar geworden, nachdem die deutsche Richterschaft sich in fünfzigjähriger, ruhiger demokratischer Entwicklung vom etatistischen Denken befreit, ein Bewusstsein ihrer Unabhängigkeit gewonnen und ihren traditionellen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der Exekutive abgelegt hat.
Obendrein erleben wir derzeit eine "Modernisierungsoffensive" der Justizverwaltungen. Mit den Schlagwörtern "Evaluation", "Benchmarking", "Neues Steuerungsmodell", "reduzierter Mitteleinsatz" und "Effizienzsteigerung" wird juristische Fließbandarbeit zum Ideal erhoben und die Rechtsprechung bürokratischen Effizienzidealen unterworfen, die für die Verwaltung passen mögen, die für sich selbst anzuwenden der Justizverwaltung freilich nicht in den Sinn kommt. Die Kollegialgerichte sollen weitgehend durch Einzelrichter ersetzt, die fünf im Grundgesetz verankerten Gerichtsbarkeiten auf zwei reduziert und die entgegen landläufiger Meinung bei uns keineswegs üppigen Rechtsmittel weiter verkürzt werden. Zur Popularität der Justiz wird das nicht beitragen, denn es würde die Qualität der Rechtsprechung beträchtlich mindern. Vor allem würde es die Richter zu alten, überwunden geglaubten Untugenden zurückzwingen. Kurt Tucholsky - selbst Jurist und schärfster Kritiker der Justiz seiner Zeit - beschrieb den deutschen Richter als einen,, "der seinen Beruf als Berufsstörung auffasst. Man hat den Eindruck, dass (die Richter) ihre Arbeit unlustig tun und nichts als das einzige Bestreben haben: möglichst rasch fertig zu werden… . Daher mürrisches, eiliges Wesen, hochfahrende Handbewegungen, Wegräumung aller Schwierigkeiten, die Zeit kosten können".
Verhängnisvoll, wenn dies das Ergebnis von 125 Jahren Justizgeschichte sein sollte, die nach so vielen Irrwegen schließlich zu einer Rechtskultur geführt hat, um welche uns inzwischen manche Länder beneiden. Die Richter können das nicht klaglos hinnehmen und sie sollten sich vielleicht des Aufrufs ihres Kollegen Carl Twesten von 1865 erinnern: "Freund, jetzt ist Zeit zu lärmen!".